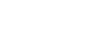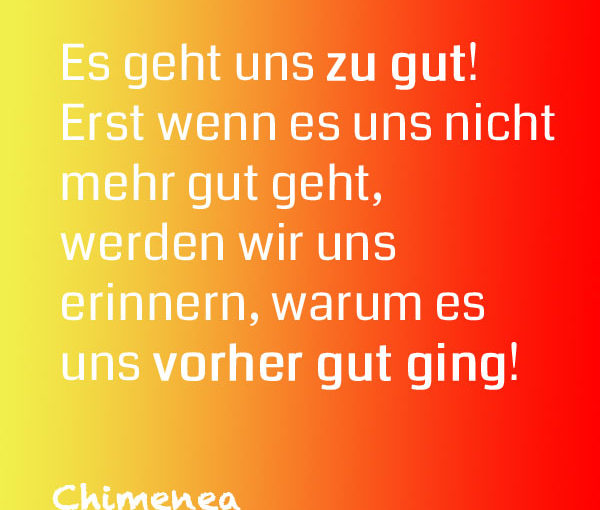G-BIP – das gefühlte Bruttoinlandsprodukt
Zielsetzung:
- Einbeziehung der Vermögensverteilung in die wirtschaftliche Masszahl.
- Ermittlung der Wahrscheinlichkeit für soziale Zufriedenheit oder Unzufriedenheit.
Annahme:
- Das BIP korrelliert mit der Vermögensverteilung. Vermutet wird eine Korrelation gemäss einer Normalverteilung.
Benötigte Masszahlen:
- BIP oder ein Äquivalent bezogen auf ein Gebiet
- Gini Koeffizient (Gini) für den Bereich des verwendeten BIP
Berechnung:
- BIP * (1 – Gini) = G-BIP (gefühltes BIP gesamt)
- G-BIP / BIP = G-BIP Index (Index für die soziale Zufriedenheit)
Prognosen/Vermutungen:
Sozialer Zerfall beginnt: ±4σ
Soziale Zufriedenheit kritisch: ±2-3σ
Soziale Zufriedenheit gut: ±0-2σ
Mögliche Werte:
Sozialer Zerfall beginnt: < 0.15 > 0.85
Soziale Zufriedenheit kritisch: (>= 0.2 <= 0.4) (>= 0.6 <= 0.8)
Soziale Zufriedenheit gut: > 0.4 < 0.6
Bewertung:
Je höher der Gini Koeffizient ist, desto ungleicher ist die Verteilung des Vermögens. Beim Wert 1 ist das Vermögen in einer Hand, das gefühlte BIP gleichsam 0 für alle ausser der Person, die das Vermögen besitzt. Bei einer hohen Gleichverteilung des Vermögens nähert sich daher das G-BIP dem ursprünglichen Wert. Es kann angenommen werden, dass jeder dann mehr partizipiert, da jeder mehr aus dem Kreislauf entnimmt und, im günstigsten Falle, wieder in gleicher oder höherer Menge dem Kreislauf hinzufügt.
Das gefühlte BIP kann derzeit noch nicht als realer Wert im Sinne der Kaufkraft verstanden werden, obwohl Untersuchungen möglicherweise zu dem Ergebnis kommen könnten, dass hier eine Relation besteht. Falls man eine Relation zur Kaufkraft herstellen möchte, ist es mindestens, neben anderen Punkten, die mir noch nicht klar sind, notwendig, dass die Güter in die Rechnung einbezogen werden, die jeweils eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erst ermöglichen, seien es heute Smartphones, Zugang zur Vernetzung etc. und morgen irgendetwas anderes. Diese sind zusätzlich zu den elementaren Grundbedürfnissen in komplexeren Gesellschaften einzubeziehen.
Im Bezug auf eine längere historische Betrachtung kann als relativ gesichert angenommen werden, dass ein zunehmende Kumulation von Macht, Besitz, Geld, was auch immer in den jeweiligen Gesellschaften dominant war, jeweils zu einer zunehmenden Instabilität der Gesellschaft geführt hat. Insofern ist der G-BIP-Index ein Instrument um die Instabilität einer Gesellschaft zu bewerten und mögliche Zerfallsprozesse zu ahnen. Die Voraussage wird dadurch behindert, dass uns kaum Rohdaten aus den geschichtlichen Ereignissen rund um den Aufstieg und Fall von Imperien vorliegen. Allenfalls können hier Mutmassungen und Annahmen getroffen werden.
Um die Anwendung zu verstehen, sind ebenfalls die Gruppendynamiken zu berücksichtigen. Es braucht 5% einer Menge, um die Menge zu beeinflussen. Diese 5% werden selten in einem Gebiet zu finden sein. Dies sollte jedoch nicht als unmöglich erachtet werden. Hier könnte die Granularität der Rohdaten für das BIP ausschlaggebend sein, um gebietsspezifisch soziale Gefahren oder Fehlentwicklungen tatsächlich zu entdecken.
Es kann daher angenommen werden, dass der G-BIP Index schon relativ niedrig sein muss, um zu sozialen Spannungen zu führen. Im Umkehrschluss muss er damit natürlich weniger hoch sein, um soziale Spannungen zu entschärfen. Dieser Gedanke hat zu den Annahmen geführt, dass ein G-BIP Index zwischen 0.4 und 0.6, bzw. für ±0-2σ bereits eine stabile Gesellschaft kennzeichnet.
Da es durchaus denkbar ist, dass ein hoher G-BIP Index ebenso problematisch wird, wie ein zu geringer, wurde auch dies berücksichtigt. Extreme haben es nun mal an sich, extrem zu sein. Egal in welche Richtung.
Gültigkeit:
- Gilt, solange Geld im limbischen System einen stärkeren Reiz als etwas anderes ausübt.
- Gilt, solange Währungen konvertierbar und Vermögen messbar sind.
- Gilt, solange Waren, Güter, Immobilien etc. in Geld bewertet werden können.
- Gilt, solange die Abweichung der angenäherten Zahlen innerhalb einer Normalverteilung (±2σ) liegen.
- Gilt, solange die Verfahren zur Ermittlung der Zahlen auf den gleichen Daten beruhen.
Einschränkungen:
- Die Genauigkeit der Zahlen ist im Gegensatz zu Physik nur insofern relevant, dass die verwendeten Zahlen eine Annäherung an die Realität darstellen und die Abweichung unter ±2σ liegt.
- Da menschliche Gemeinschaften immer auf variablen Werten beruhen, die sich im Laufe der Zeit ändern können, müssen die Gültigkeit und die verwendeten Verfahren zur Erstellung der Daten immer wieder einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Verwendung von unverfälschten ungefilterten Rohdaten wäre allem anderen vorzuziehen, dürfte aber in der Praxis immer noch schwer machbar sein.
- Die Beschaffung der Daten für den Gini Koeffizienten und das BIP eines Gebietes wird als schwierig und problematisch erachtet. Statistische Ämter und Veröffentlichungen sind eine Notlösung, wenn die Rohdaten nicht zur Verfügung stehen.
- Je grösser das Erhebungsgebiet, desto mehr Ausgleichseffekte können auftreten (z.B. zwei Gebiete mit gegensätzlichen Extremen sind in der Gesamtbetrachtung nicht mehr sichtbar, bzw. heben sich gegenseitig auf).
- Es bestehen die jeweiligen Einschränkungen, die für die jeweilige Grundlage der Berechnung eines BIP oder Gini gelten (Abweichungen, Ungenauigkeiten). Es ist davon auszugehen, dass sich Ungenauigkeiten in der Messung von Gini und BIP, so sie nicht auf der gleichen Datengrundlage stattfinden, gegenseitig verstärken oder abschwächen. Es kann nur dringend darauf hingewiesen werden, dass beide Werte die gleichen Rohdaten zur Ermittlung benutzen.
Bis dato ermittelte Zahlen:
Die Spalte „zufrieden?“ ist der G-BIP Index in Prozent, die Spalte „unzufrieden?“ der Kehrwert. Ob diese Annahmen so richtig sind, ist noch zu beweisen.
| BRD | Gini | BIP in Mrd | G-BIP in Mrd | zufrieden? | unzufrieden? |
| 2000 | 0.667 | 2116.48 | 704.79 | 33.30% | 66.70% |
| 2014 | 0.760 | 2932.47 | 703.79 | 24.00% | 76.00% |
| 2016 | 0.789 | 3144.05 | 663.39 | 21.10% | 78.90% |
Es kann angemerkt werden, dass zumindest diese eingeschränkte Auswahl an Zahlen durchaus mit dem Gefühl der Bevölkerung zu korrelieren scheint, dass trotz Wirtschaftswachstum die Situation eher schlechter als besser eingeschätzt wird.
Interessant ist auch der Effekt des Gini Koeffizienten auf die Zufriedenheit, den G-BIP Index. Obwohl das G-BIP zwischen 2000 und 2014 relativ stabil geblieben ist, zeigt der G-BIP Index, dass hier eine massive Verschiebung stattgefunden hat. Die Grösse des G-BIP ist also unrelevant, solange sie nicht im Bezug zum BIP steht. Das heisst weiterhin, sollten alle Annahmen stimmen, dass ein Wachstum überhaupt nicht notwendig ist, um soziale Zufriedenheit zu erreichen und zu halten. Lediglich die Umverteilung des BIP ist relevant.
[work in progress – weitere Daten folgen]